
©Philipp Horak
Im gestrigen Unterrichtsausschuss ging’s inhaltlich zur Sache. Und es wurde konkret. Mit der Erlaubnis des Vaters und in Absprache mit ihm hier die konkrete Geschichte eines Kindes:
Als die Zeit der Anmeldung für die Volksschule näher rückt, ist den Eltern klar: „Emil soll in die gleiche Schule gehen, die auch sein großer Bruder besucht.“ Als Geschwisterkind müsste die Anmeldung nur ein Formalakt sein. Doch weit gefehlt. Bei der Einschreibung bekommen Emils Eltern die Auskunft, dass ihr Sohn nur unter Maßgabe der zur Verfügung stehenden SonderschullehrerInnenstunden am Schulstandort aufgenommen werden kann. Schon sein bisheriger Bildungsweg war gespickt mit „Neins“ und Hürden, denn Emil hat das Down Syndrom. „Ob Emil nicht besser in einer Sonderschule aufgehoben wäre“, fragt die Direktorin? „Nein!“ Die Eltern sind entschieden dagegen. Emil soll an der Gesellschaft teilhaben, mit Gleichaltrigen gemeinsam aufzuwachsen in einer Umgebung, die so divers ist, wie die Menschheit! Das wollen sie für beide Söhne, für den mit Down Syndrom genauso wie für den ohne.
Wäre Emil in Südtirol zuhause, hätten sich diese Fragen gar nicht erst gestellt. In Südtirol hat jedes Kind das Recht, die nächstgelegene Volksschule zu besuchen. Hat das Kind z.B. auf Grund einer Erkrankung oder einer Behinderung einen besonderen Bedarf, so muss die Schule dafür Sorgen tragen, dass alle Voraussetzungen erfüllt werden, um den Schulbesuch zu ermöglichen. Persönliche Assistenz, eine sonderpädagogisch ausgebildete Lehrkraft, ein individueller Lehrplan oder Rückzugsräume? Alles kein Problem!
Der Kleine durfte schon nicht den Kindergarten ums Eck besuchen. Seine Eltern mussten ihn der Bezirkspsychologin vorstellen, die Emil einen geeigneten Platz zuweisen würde. Aber warum ist der Kindergarten, den Emils großer Bruder besucht und wo er schon erste Kontakte zu Kindern und Betreuerinnen geknüpft hat, nicht geeignet?
Und jetzt auch noch Probleme mit der Volksschule. Wieder eine Begutachtung – diesmal im Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik. Schule ist bei uns individualzentriert und nicht systemzentriert, d.h., das Kind muss beweisen, wo es reinpasst, und nicht das System muss zur Verfügung stellen, was das Kind braucht. Im Grunde können Eltern die Schule für ihr Kind frei wählen. War ein Geschwisterkind bereits in der Volksschule, wird man quasi automatisch aufgenommen – im Falle einer Behinderung ist es aber davon abhängig, ob genügend Kinder mit einer Behinderung angemeldet sind und ein/e SonderschullehrerIn auch in der jeweiligen Volksschule zugeteilt werden kann. Nach kurzem bangem Warten hatte Emil den Wunschplatz.
Die vielbeschworene Wahlfreiheit haben Eltern behinderter Kinder nicht. Wollen sie ihr Kind nicht in eine Sonderschule geben, sondern ihnen die Entwicklung in einer diversen und durchaus herausfordernden, dafür aber lebensnahen Umgebung ermöglichen, müssen sie viele Kompromisse eingehen, Behördenhindernisse überwinden, Überzeugungsarbeit leisten und sich vielfach auch im eigenen Umfeld rechtfertigen. Denn obwohl Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat und Kinder ein Recht auf inklusive Bildung haben, ist sie noch lange nicht selbstverständlich.
Immerhin kann Emil die Nachmittagsbetreuung an der Schule besuchen. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Betreuung wird nicht von der Schule selbst, sondern von einem Verein organisiert. Wieder müssen mindestens vier Kinder mit Behinderung für die Nachmittagsbetreuung angemeldet sein, damit eine zusätzliche Person bereitgestellt wird. Sind es weniger, ist die Betreuung nicht möglich. Jedes Jahr also neuerliches Bangen, ob genügend Kinder angemeldet sind.
Tatsächlich ist die Frage, ob es eine geeignete Betreuung am Nachmittag gibt, eines der größten Hindernisse bei der Inklusion. Bieten die Sonderschulen doch eine Rundumbetreuung, inklusive Fahrtendienst und Therapieangeboten. In Regelschulen ist das nicht immer und wenn, dann nur nach Überwindung vieler Hürden möglich.
In Modellregionen zur Inklusiven Schule sollen gemeinsame Lern- und Lebensräume entstehen. Vorreiter in Österreich ist derzeit Kärnten. Dort sind in sieben von zehn Bezirken die Sonderschulen abgeschafft. Jedes Kind besucht eine wohnortnahe Regelschule, die Sonderpädagogik, Therapien, Betreuung und Pflege anbietet. Bei Bedarf können Kleingruppen eingerichtet werden oder Time-Out-Räume aufgesucht werden. Das Land hat seine Kräfte gebündelt und stellt alle Mittel, die für die Betreuung und Beschulung von SchülerInnen mit Behinderungen zur Verfügung stehen, den Schulen bereit. Die zuständige Landesschulinspektorin Dr. Dagmar Zöhrer antwortet im Ausschuss daher auf die Frage, ob denn wirklich jedes Kind eine Inklusive Schule besuchen kann, sehr bestimmt mit: „Ja. Man muss nur wissen, was man braucht.“
Emil wohnt nicht in Kärnten. Sein Hürdenlauf ist noch nicht vorbei. Denn mit dem Wechsel von der Volksschule in die Neue Mittelschule endet für den Elfjährigen die Möglichkeit der Inklusiven Nachmittagsbetreuung. Im Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik bekamen Emils Eltern die Auskunft: „Sie können Emil in die Sonderschule geben oder er kann, bis er zwölf ist, mit dem Fahrtendienst in den Sonderhort geführt werden. Ab da muss er nach der Schule abgeholt werden.“ Eine klare behördliche Diskriminierung.
Mit Hilfe des Elternvereins und der LehrerInnen, mit vielen Unterschriften in einer Onlinepetition, mit vielen E-Mails, mit Gesprächen und vielen Telefonaten gelang es, die Nachmittagsbetreuung für Emil zu erkämpfen. 2016 war er das erste Kind mit Sonderpädagogischem Förderbedarf, das dies darf. Sein Vater drückt es so aus: „Wir verstecken unsere Mitmenschen mit Behinderungen vor der Gesellschaft. Wir führen sie von einer Sondereinrichtung mit einem eigenen Fahrtendienst in die nächste Sondereinrichtung.“
Obwohl Emil für seine Entwicklung länger braucht als Gleichaltrige, ist seine Schulzeit voraussichtlich wesentlich kürzer. Sie endet für ihn nach der 9. Schulstufe. Nur in der Sonderschule könnte er noch ein bis zwei weitere Jahre verbleiben, bevor er eine Lehre beginnen müsste. Denn auch für Emil gilt die Ausbildungspflicht, ein Recht auf einen Ausbildungsplatz oder den Schulbesuch bis 18 hat er aber nicht. Dabei ist es doch das Ziel aller Inklusionsbemühungen, dass alle Menschen ihren Platz in der Gesellschaft finden.
„Wir wünsche uns für unseren Sohn eine Gesellschaft, die mit seiner Behinderung umgehen kann und ihn nicht diskriminiert und dass er mit seiner Behinderung in der Gesellschaft gut zurechtkommt“, sagt Emils Vater.
Auch die Gesellschaft muss den Umgang mit Menschen mit Behinderungen (wieder) lernen. Die MitschülerInnen von Emil werden später seine ArbeitskollegInnen oder KundInnen, seine Vorgesetzten oder NachbarInnen sein. Sie profitieren davon, wenn sie von klein auf mit der Diversität ihrer Mitmenschen aufwachsen. Wenn sie erfahren, dass jemand anders und doch genauso wertvoll sein kann. Nichts anderes bedeutet Inklusion: Die Menschen nehmen, wie sind.
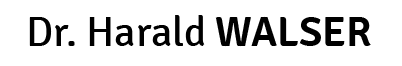

Das ist eine individuelle Geschichte, von einem Burschen, der es anscheinend und erfreulicherweise schafft, trotz seiner Behinderung in einer Regelklasse zurecht zu kommen. Das kann man aber nicht verallgemeinern. Es gibt Kinder, die halten den Lärm nicht aus und reagieren mit massiven Tics. Manche sind frustriert, weil sie mit dem Tempo der anderen nicht mithalten können. Viele behinderte Kinder kommen zwar im Kindergarten gut mit den anderen, den „normalen“ Kindern, aus, in der Volksschule geht es auch noch so halbwegs, aber irgendwann ist das nicht mehr ihre „Peergroup“. In der Einrichtung, in der ich arbeite, haben wir oft erlebt, dass Kinder, die große Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben, die aggressiv waren, gegen andere und/oder sich selbst, die einfach gestresst waren, in einer Sonderschule wieder zur Ruhe gekommen sind, wieder den Kopf frei bekommen haben, Freunde mit gleichen Interessen gefunden haben und sich wieder weiter entwickelt haben. Inklusion ist fein, dort wo sie sinnvoll ist, aber wer die Sonderschulen abschafft, nimmt Kindern mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit der besonderen Beschulung.
Ich verstehe Ihre Sorgen, gebe aber zu bedenken, dass bspw in Südtirol oder den skandinavischen Ländern auch für solche Fälle – individuelle – Lösungen gefunden wurden.