Braucht es wirklich „Sonderschulen“?
 In einem Kommentar in den „Vorarlberger Nachrichten“ habe ich ein Plädoyer für ein inklusives Bildungssystem gehalten: „Sonderschule?“. Eine angesprochene Schule in Feldkirch hat mich in einem Leserbrief wüst beschimpft und in die Schule „eingeladen“. Ich habe natürlich sofort zugesagt, aber seither leider nichts mehr gehört.
In einem Kommentar in den „Vorarlberger Nachrichten“ habe ich ein Plädoyer für ein inklusives Bildungssystem gehalten: „Sonderschule?“. Eine angesprochene Schule in Feldkirch hat mich in einem Leserbrief wüst beschimpft und in die Schule „eingeladen“. Ich habe natürlich sofort zugesagt, aber seither leider nichts mehr gehört.
Eine andere „Sonderschule“ in Lustenau hat mich gleichzeitig weniger spektakulär und weniger medienwirksam eingeladen. Auch dort habe ich natürlich sofort zugesagt und auch einen Termin bekommen: Es war ein spannender Vormittag in Lustenau, und ich schätze die exzellente Arbeit der Lehrkräfte dort sehr. Schön auch, dass wir uns im Ziel – der Inklusion – einig waren und nur den Weg dorthin etwas unterschiedlich sehen. Hier mein Kommentar zum Nachlesen, weil der Link oben eventuell nur einegschränkt funktioniert: Sonderschule
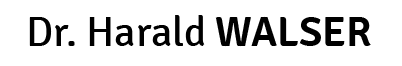
 In den „Vorarlberger Nachrichten“ habe ich in
In den „Vorarlberger Nachrichten“ habe ich in  Um es – bezogen auf die Überschrift – kurz zu machen: Es blieb jedenfalls viel zu viel als Erbe der NS-Zeit. Dazu gehörten nicht nur, aber vor allem in den ersten Jahrzehnten nach 1945 Macht-Strukturen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, Ideologie etc. – und eine in mehrfacher Hinsicht „belastete“ Bevölkerung. Traumatisiert wurden nicht nur die Opfer (und TäterInnen), sondern jeweils auch ihre Nachfahren bis in die vierte Generation.
Um es – bezogen auf die Überschrift – kurz zu machen: Es blieb jedenfalls viel zu viel als Erbe der NS-Zeit. Dazu gehörten nicht nur, aber vor allem in den ersten Jahrzehnten nach 1945 Macht-Strukturen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, Ideologie etc. – und eine in mehrfacher Hinsicht „belastete“ Bevölkerung. Traumatisiert wurden nicht nur die Opfer (und TäterInnen), sondern jeweils auch ihre Nachfahren bis in die vierte Generation.