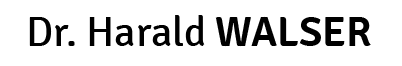Budgetkrise: Wer zahlt die Zeche?
 Fast täglich eine Horrormeldung zur Budgetsituation. Und sogar den Neoliberalen in der ÖVP und bei den Neos ist klar, dass wir nicht nur durch Sparen aus der Misere herauskommen. Doch wo soll der Staat bei der einnahmenseitigen Sanierung ansetzen? Unter dem Titel „Wer zahlt die Zeche?“ habe ich dazu in den Vorarlberger Nachrichten diesen Kommentar veröffentlicht:
Fast täglich eine Horrormeldung zur Budgetsituation. Und sogar den Neoliberalen in der ÖVP und bei den Neos ist klar, dass wir nicht nur durch Sparen aus der Misere herauskommen. Doch wo soll der Staat bei der einnahmenseitigen Sanierung ansetzen? Unter dem Titel „Wer zahlt die Zeche?“ habe ich dazu in den Vorarlberger Nachrichten diesen Kommentar veröffentlicht:
Der neue Finanzminister ist nicht zu beneiden. Sein Vorgänger hat ihm ein Budget-Desaster hinterlassen. Der Schuldenberg wächst und natürlich stellt sich die große Frage: Wer zahlt die Zeche? Wie konsolidiert man ein aus den Fugen geratenes Budget ohne soziale Härten und kontraproduktives Sparen etwa in den Bereichen Gesundheit oder Bildung? Wie vermeidet man gleichzeitig ein Abwürgen der ohnehin kränkelnden Konjunktur?
Einerseits muss gespart werden, andererseits aber braucht die Wirtschaft Impulse – also ähnlich wie derzeit in Deutschland staatliche Investitionen. Das erfordert von allen eine offene Diskussion ohne sturem Festhalten an althergebrachten ideologischen Positionen.
Gefordert sind vor allem die Regierungsparteien, aber auch die Opposition. Leider hört man von allen derzeit nur wenig Konkretes zu diesem Thema. Das globalisierungskritische Netzwerk Attac hingegen hat letzte Woche einen Vorschlag gemacht und weist darauf hin, dass in der gegenwärtigen Situation auch von den Reichsten ein fairer Beitrag zur Budget-Sanierung eingefordert werden muss. Attac landet folgerichtig bei Vermögens- und Erbschaftsteuern.
Österreich könne „problemlos“ jährlich sieben Milliarden Euro mehr einnehmen, wenn wir die vermögensbezogenen Steuern auf den Durchschnitt (!) der Industrie-Staaten anheben. Denn derzeit ist unser Land ein Steuerparadies für Superreiche und sehr Reiche. Wenn man bedenkt, dass sich in den letzten Jahrzehnten das Vermögen der Milliardäre alle sieben Jahre verdoppelt hat, ist ein zusätzlicher Beitrag in die Staatskasse zumutbar.
Ökonomen weisen darauf hin, dass Vermögensteuern auch wirtschaftspolitisch das richtige Rezept sind. Sie führen zu keinem erwähnenswerten Rückgang des Konsums, eröffnen Spielräume für Investitionen in Bildung, Pflege sowie Infrastruktur und sichern somit Arbeitsplätze.
Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: Der französische Ökonom Thomas Piketty hat nachgewiesen, dass die Vermögensungleichheit weltweit auf das Niveau der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gewachsen ist. Das stärkt rechtsextreme Bewegungen und gefährdet die Demokratien. Ein Blick in die USA reicht, aber auch Staaten wie Frankreich, Italien oder Deutschland sind damit konfrontiert. Von Ungarn ganz zu schweigen.
Und Österreich? Auch hierzulande ist die Schere zwischen den wenigen Superreichen und dem Rest der Bevölkerung weit auseinandergegangen. Wir haben sogar die zweitgrößte Vermögenskonzentration in der Eurozone: Der mehrfach ausgezeichnete Ökonom Matthias Schnetzer rechnet vor, dass die reichsten fünf Prozent etwa 59 Prozent des gesamten Haushaltsvermögens besitzen: rund zwei Billionen Euro. Der Hauptgrund dafür sind steuerfreie Erbschaften – und nicht die von konservativer Seite immer wieder beschworene Leistungsbereitschaft. Es sollte also klar sein, wo einnahmenseitig anzusetzen ist.