Peinlich: Österreich und die Flüchtlinge

Es ist erschreckend, was derzeit an Hass und Gewalt zutage tritt. Auf den Ägäis-Inseln prügeln rechtsradikale Schläger Flüchtlinge krankenhausreif, Soldaten gehen an den türkischen Grenzen mit Tränengas und Waffengewalt gegen Schutzsuchende vor und die EU zeigt dafür sogar Verständnis. Bei uns sind Leserbriefseiten voll mit Angstmache und absurden Unterstellungen gegenüber Flüchtlingen. Die verbalen Hasskrieger werden immer lauter.
Kriegsrhetorik
Die Kurz-ÖVP segelt voll auf Linie des ehemaligen blauen Koalitionspartners. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verliert sich in Allgemeinplätzen und drückt sich trotz mehrmaliger Reporter-Nachfrage vor einem klaren Bekenntnis zu einer humanen Flüchtlingspolitik. Und die Grünen? Sie schlagen zwar andere Töne an, vom Durchsetzen der eigenen Position aber keine Spur. Man ergibt sich in das Koalitions-Schicksal.
Die FPÖ dreht wieder mal an der Eskalationsschraube: Ihr ehemaliger Innenminister Herbert Kickl spricht davon, „illegale Einwanderer“ würden alsbald Österreichs Grenze „attackieren“. Er fordert vorsorglich den Einsatz von Tränengas und „natürlich“ Waffeneinsatz gegen noch gar nicht vorhandene „Horden“ an unseren Grenzen. Kickl phantasiert eine Kriegssituation herbei, und kaum jemanden regt sich über diesen unsäglichen Sprachgebrauch auf. Das Gift des Hasses und der Angstmache ist mitten in unserer Gesellschaft.
Es gibt auch andere Stimmen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen verlangt einen größeren Beitrag Österreichs zur Lösung der aktuellen Flüchtlingskrise. In Oberösterreich erklären 20 SPÖ-Bürgermeister bereit, Flüchtlinge aufnehmen. Der Grüne Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi will 200 bedrohte Menschen Unterkunft geben. Auch ÖVP-Bürgermeister wie Lustenaus Kurt Fischer sehen „Möglichkeiten für einen Beitrag zur Menschlichkeit“.
Was kann man tun?
Am wichtigsten ist natürlich, bedrohte Menschen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich zu bringen. Das gab es schon von 2013 bis 2017: Damals hat Österreich syrische Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsgebiet zu uns geholt – mit Zustimmung des jetzigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, der heute völlig andere Töne anklingen lässt.
Hilfe vor Ort leistet am besten das UNHCR, das UNO-Flüchtlingskommissariat. Dafür braucht es Geld. Letzte Woche wurden die heurigen Beiträge der einzelnen Staaten veröffentlicht: Mit Österreich vergleichbare Länder wie Dänemark (83 Millionen US-Dollar), Schweden (82 Millionen) und die Niederlande (73 Millionen) zahlen kräftig.
Deutschland beteiligte sich mit 127 Millionen und stellt jetzt darüber hinaus zusätzliche 100 Millionen Euro für die Region Idlib zur Verfügung, Österreich will aus dem Katastrophenhilfsfonds drei Millionen bereitstellen. An das UNHCR zahlte Österreich übrigens – wie das Nachrichtenportal „dieSubstanz.at“ aufgedeckt hat – ganze 23. Nein, nicht 23 Millionen, ganze 23.000 Dollar.
Man geniert sich für unser Land.
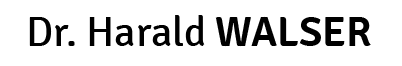
 In den „Vorarlberger Nachrichten“ habe ich Österreichs Positionierung zur EU-Mission „Sophia“ und zur Flüchtlingsthematik insgesamt kommentiert. Mein Resümee: eine Peinlichkeit!
In den „Vorarlberger Nachrichten“ habe ich Österreichs Positionierung zur EU-Mission „Sophia“ und zur Flüchtlingsthematik insgesamt kommentiert. Mein Resümee: eine Peinlichkeit! Konservative Kritiker der alternativen Leistungsbeurteilung bis hin zum Minister geben sich gerne großzügig und „erlauben“ zusätzlich zur verpflichtenden Ziffernnote in der Volksschule eine alternative Beurteilung. Völlig abgesehen davon, dass ich es für unzumutbar halte, dass Pädagog*innen genötigt werden, doppelte Arbeit zu leisten, habe ich eine interessante Zusendung quasi „aus der Praxis“ bekommen.
Konservative Kritiker der alternativen Leistungsbeurteilung bis hin zum Minister geben sich gerne großzügig und „erlauben“ zusätzlich zur verpflichtenden Ziffernnote in der Volksschule eine alternative Beurteilung. Völlig abgesehen davon, dass ich es für unzumutbar halte, dass Pädagog*innen genötigt werden, doppelte Arbeit zu leisten, habe ich eine interessante Zusendung quasi „aus der Praxis“ bekommen.