Wie weiter in der Ukraine?
 Wie kann eine Exit-Strategie aus dem Ukraine-Krieg ausschauen? Darüber wird in den kommenden Tagen und Wochen hoffentlich intensiv nachgedacht werden. Was besonders Angst macht: Mit Putin ist eine Nachkriegsordnung nicht vorstellbar, aber er sitzt – so macht es jedenfalls den Eindruck – fest im Sattel. Was aus meiner Sicht dennoch wichtig ist: Russland ist nicht Putin! Unter dem Titel „Desaster im Osten“ habe ich zu diesem Problem Stellung bezogen. Hier zum Nachlesen:
Wie kann eine Exit-Strategie aus dem Ukraine-Krieg ausschauen? Darüber wird in den kommenden Tagen und Wochen hoffentlich intensiv nachgedacht werden. Was besonders Angst macht: Mit Putin ist eine Nachkriegsordnung nicht vorstellbar, aber er sitzt – so macht es jedenfalls den Eindruck – fest im Sattel. Was aus meiner Sicht dennoch wichtig ist: Russland ist nicht Putin! Unter dem Titel „Desaster im Osten“ habe ich zu diesem Problem Stellung bezogen. Hier zum Nachlesen:
Der verbrecherische Angriff der Truppen Wladimir Putins auf die Ukraine ist ein Zivilisationsbruch, der uns erschauern lässt und zum Nachdenken führen muss. Das betrifft einerseits unsere Sicherheit, die deutlich fragiler ist, als wir geglaubt haben. Nachdenken müssen die Verantwortlichen in Ost und West aber vor allem darüber, wie eine halbwegs stabile Ordnung künftig ausschauen kann.
Aus Geschichte lernen
Kann man aus der Geschichte lernen? Man kann! Nach dem 1. Weltkrieg waren die Erwartungen groß, man kündigte ein Ende der Geheimdiplomatie und den Abbau von Handelsschranken an, versprach globale Abrüstung, nationale Selbstbestimmung und mit dem Völkerbund dauerhaften Frieden.
Das Ergebnis ist bekannt: Die als Demütigung empfundenen Friedensverträge schufen vor allem in Deutschland den Nährboden für den Nationalsozialismus und waren Mitursache für den 2. Weltkrieg. Vor allem die USA zogen ihre Lehren daraus: Nach dem 2. Weltkrieg unterblieb eine weitere Demütigung Deutschlands. Ganz im Gegenteil. Mit dem „Marshallplan“ wurde nicht nur die Grundlage für das deutsche Wirtschaftswunder gelegt, sondern ganz Westeuropas geholfen − Österreich profitierte übrigens am stärksten.
Russland nicht isolieren
Die Nachkriegsordnung war für Europa allerdings schmerzlich. Bis zum Fall des Eisernen Vorhangs blieb der Kontinent geteilt. Ab 1989 tat sich eine riesengroße Chance für ein friedliches Zusammenleben auf.
Der ehemaligen Weltmacht Russland wurde viel versprochen. Im Ringen um die deutsche Einheit forderte der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher, „was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine Ausdehnung des Nato-Territoriums nach Osten, das heißt, näher an die Grenzen der Sowjetunion heran, wird es nicht geben“. Nicht einmal auf dem Gebiet der ehemaligen DDR wolle man NATO-Truppen stationieren. Der US-Außenminister James Baker übernahm diese Position, nichts davon wurde allerdings in verbindlichen Verträgen festgehalten.
Im Gegenteil: Heute steht die NATO in den baltischen Staaten und somit direkt an der russischen Grenze, und die Bemühungen der Ukraine um einen NATO-Beitritt sind hinlänglich bekannt. Die russischen Präsidenten – von Michael Gorbatschow über Boris Jelzin bis zu Wladimir Putin − haben dem fast widerspruchslos zugesehen. Noch im Jahr 2000 meinte Putin: „Ich kann mir die NATO nur schwerlich als einen Feind vorstellen.“ Damals stand noch eine politische und unter Umständen sogar militärische Integration Russlands in die westlichen Bündnisse im Raum. Heute ist die Sachlage anders.
Mit dieser Situation müssen die Verantwortlichen umgehen. Das ist schwierig genug, zumal sich Russland durch den Angriff auf die Ukraine selbst isoliert hat. Wir können nur hoffen, dass eine (weitere) Demütigung Russlands wie 1919 in Versailles für Deutschland unterbleibt. Mit Putin allerdings ist eine neue Friedenordnung nicht vorstellbar.
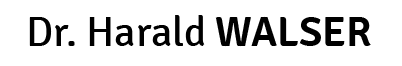
 Die Diskussionen zu diesem Thema waren ärgerlich und keimten vor allem durch aberwitzige Plakate bei Corona-Demonstrationen auf: Wer erinnert sich nicht an das unsägliche „Impfen macht frei“, das an den zynischen Spruch „Arbeit macht frei“ über dem Konzentrationslager Auschwitz und anderen KZs erinnerte? Was bedeutet „Faschismus“? Ist es wirklich nur eine Definitionsfrage?
Die Diskussionen zu diesem Thema waren ärgerlich und keimten vor allem durch aberwitzige Plakate bei Corona-Demonstrationen auf: Wer erinnert sich nicht an das unsägliche „Impfen macht frei“, das an den zynischen Spruch „Arbeit macht frei“ über dem Konzentrationslager Auschwitz und anderen KZs erinnerte? Was bedeutet „Faschismus“? Ist es wirklich nur eine Definitionsfrage?