Zur Geschichtsvergessenheit der österreichischen „Mitte“

Identitärer Demonstrationsteilnehmer mit nazistischem Sonnenrad als Tätowierung
Ja, wo ist der Widerstand der Mitte, wenn die Identitären und ihresgleichen auf die Straße gehen? Das frage auch ich mich. Meine Antworten sind allerdings anders, als sie der NZZ-Journalist Georg Renner in seinem Beitrag „Identitäre in Wien: Wo ist der Widerstand der Mitte?“ gegeben hat. Eigentlich wäre ausgangs zu definieren, was denn die Mitte ist. Immerhin moniert inzwischen ja schon Straches FPÖ für sich, die Mitte unserer Gesellschaft zu repräsentieren. Wo die Mitte liegt, ist also je nach BetrachterIn sehr unterschiedlich.
Ich stelle die Frage zudem etwas erweitert: Warum gibt es hierzulande nicht nur keine breiten Proteste gegen die Identitären, sondern auch nicht gegen Rechtsextremismus und Neonazismus im Allgemeinen?
„Das kann man wahlweise sympathisch oder lethargisch finden, aber man sollte nicht den Fehler machen anzunehmen, dass es keinen antifaschistischen Grundkonsens gäbe, nur weil beim Anblick einiger Rechtsextremer nicht sofort die halbe Republik im Lichtermeer-Modus auf die Straßen strömt.“ (Georg Renner)
Der antifaschistische Grundkonsens, den Renner anspricht, ist im Artikel 9 des Staatsvertrags formuliert und wurde von Beginn an gebrochen. Wer behauptet, er sei jemals durchgehend gesellschaftliche Realität in Österreich gewesen, belügt sich und andere. Das Vertuschen und Verdrängen war ungeschriebene Staatsdokrin in der Zweiten Republik, wer dagegen auftrat, galt als Nestbeschmutzer. Ich erinnere etwa an die Zeithistorikerin Erika Weinzierl, die als Vorreiterin für eine Aufklärung über Austrofaschismus und Nationalsozialismus viele Anfeindungen gerade aus der „Mitte“, nämlich „ihrer“ ÖVP, ertragen musste.
Dass in Österreich Widerstand nicht auf der Straße geleistet wird, ist richtig, dass er auch anderswo kaum passiert, wäre anzufügen. Dass dies auf die Ereignisse der Ersten Republik zurückzuführen sei, ist bestenfalls eine Teilerklärung, denn die historischen Erfahrungen gehen viel weiter zurück, und ihre Kontinuitäten wirken bis heute. Wer hierzu Nachhilfe benötigt, möge „Der lange Schatten des Staates“ von Ernst Hanisch, der bis in die Gegenreformation zurückgreift, studieren.
Die größte Fehleinschätzung begeht Renner allerdings mit der Diagnose, die Identitären seien bedeutungslos, und das Ignorieren sei das Patentrezept gegen sie. Dass sich hierzulande Rechtsextreme breit machen, ihre Parolen bis in die „Mitte“ hineindringen, sehen wir nicht zuletzt an den jüngsten Wahlergebnissen. Die Vernetzungen der Identitären reichen zu Neonazis und gehen in die FPÖ hinein, was der Verfassungsschutz belegt – deutlich detaillierter aber der von uns präsentierte Rechtsextremismusbericht. Hans Rauscher schreibt dazu im Standard: „Sehr wichtig wäre, dass auch konservative, bürgerliche Demokraten begreifen, was diese sich auf ‚Identität’ berufende ‚neue Rechte’ wirklich ist.“ Der stärker werdende organisierte Rechtsterrorismus in Deutschland macht nicht an der Staatsgrenze halt. Diese Entwicklungen von einer Gruppe abzutrennen und sie zu ignorieren, ist schlichtweg fahrlässig.
Georg Renner rät, sich am Heldenplatz zu versammeln, während Rechtsextreme und Neonazis in der Stadt demonstrieren. Weiß er nicht, dass die bis 2012 jährlich abgehaltene neonazistische Trauerfeier am 8. Mai am Heldenplatz deswegen ein Ende hatte, weil es vorher genau dort Proteste gab und dass einer der Mitinitiatoren des nun am Heldenplatz stattfindenden „Fests der Freude“, Willi Mernyi, auch dort physisch demonstriert hat? Aber „die Mitte“ vergisst sehr schnell und ruht sich just auf dem aus, was andere nicht zuletzt auf der Straße erkämpft haben, nämlich auf Demokratie und Meinungsfreiheit. Wenn „die Mitte“ aber weiterhin keinen Widerstand leistet und nicht einmal am Heldenplatz steht, wenn es darauf ankommt, könnte es irgendwann sehr ungemütlich werden – auch für die von Renner angesprochene „Mitte“.
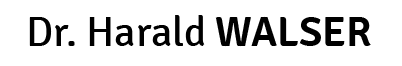
 Demnächst steht im Parlament ein schwieriges Thema zur Verhandlung an: das „
Demnächst steht im Parlament ein schwieriges Thema zur Verhandlung an: das „ Es ist das eingetreten, was absehbar war: Die AfD hat bei den Landtagswahlen in Deutschland abgeräumt und die deutsche Parteienlandschaft gehörig durcheinander gewirbelt. Die etablierten Parteien stehen der AfD genauso ratlos gegenüber wie hierzulande unsere Parteien der FPÖ. Der Wahlsieg von Winfried Kretschmann ist der One-Man-Show eines Politikers zu verdanken, der die traditionell konservativ-bürgerliche WählerInnenschaft in Baden-Württemberg abholen konnte – nicht zuletzt deshalb, weil der dortige Landes-CDU-Chef Guido Wolf mit seinen Steilvorlagen für die Heute-Show vermutlich mehr Präsenz erreichte, als durch politisch gehaltvolle Aussagen. Kretschmanns Erfolg ist durchaus in einer Tradition zu sehen: Zwischen 1978 und 1991 war mit Lothar Späth ein Mann Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der kurz nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl die Kernenergie als Übergangsenergie bezeichnete, der das Nachdenken über Alternativen forcierte und eine Versöhnung von Ökonomie und Ökologie postulierte. Wäre Späth nicht über eine Bestechungsaffäre gestolpert, hätte er ausgezeichnete Chancen gehabt, den damaligen Bundeskanzler Kohl zu beerben. Kretschmann kann durchaus als Erbe von Späth gesehen werden. Er gilt als authentisch wirkender Bewahrer, ein Bild, das in einem seiner
Es ist das eingetreten, was absehbar war: Die AfD hat bei den Landtagswahlen in Deutschland abgeräumt und die deutsche Parteienlandschaft gehörig durcheinander gewirbelt. Die etablierten Parteien stehen der AfD genauso ratlos gegenüber wie hierzulande unsere Parteien der FPÖ. Der Wahlsieg von Winfried Kretschmann ist der One-Man-Show eines Politikers zu verdanken, der die traditionell konservativ-bürgerliche WählerInnenschaft in Baden-Württemberg abholen konnte – nicht zuletzt deshalb, weil der dortige Landes-CDU-Chef Guido Wolf mit seinen Steilvorlagen für die Heute-Show vermutlich mehr Präsenz erreichte, als durch politisch gehaltvolle Aussagen. Kretschmanns Erfolg ist durchaus in einer Tradition zu sehen: Zwischen 1978 und 1991 war mit Lothar Späth ein Mann Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der kurz nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl die Kernenergie als Übergangsenergie bezeichnete, der das Nachdenken über Alternativen forcierte und eine Versöhnung von Ökonomie und Ökologie postulierte. Wäre Späth nicht über eine Bestechungsaffäre gestolpert, hätte er ausgezeichnete Chancen gehabt, den damaligen Bundeskanzler Kohl zu beerben. Kretschmann kann durchaus als Erbe von Späth gesehen werden. Er gilt als authentisch wirkender Bewahrer, ein Bild, das in einem seiner 