Eskaliert der Ukraine-Konflikt?
 Unfassbar, was für Aussagen in Sachen Ukrainekrieg zuletzt zu hören waren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zieht gar eine Eskalation und den Einsatz europäischer Soldaten in der Ukraine in Betracht. Dieses Spiel mit dem Feuer ist skandalös. Jetzt rächt sich, dass in den vergangenen zwei Jahren kaum Gedanken darüber verschwendet wurden, wie man das Töten beenden kann. Jeder Gedanke dazu wurde umgehend als„Putin-Versteherei“ diskreditiert. Unter dem Titel „Diplomatie vonnöten“ habe ich das in einem Kommentar in den Vorarlberger Nachrichten thematisiert. Hier zum Nachlesen:
Unfassbar, was für Aussagen in Sachen Ukrainekrieg zuletzt zu hören waren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zieht gar eine Eskalation und den Einsatz europäischer Soldaten in der Ukraine in Betracht. Dieses Spiel mit dem Feuer ist skandalös. Jetzt rächt sich, dass in den vergangenen zwei Jahren kaum Gedanken darüber verschwendet wurden, wie man das Töten beenden kann. Jeder Gedanke dazu wurde umgehend als„Putin-Versteherei“ diskreditiert. Unter dem Titel „Diplomatie vonnöten“ habe ich das in einem Kommentar in den Vorarlberger Nachrichten thematisiert. Hier zum Nachlesen:
Die amerikanische Regierung, die UNO, die EU – sie alle mahnten Israel in den letzten Wochen angesichts der vielen Opfer im Gazastreifen zur Mäßigung. Dabei ist unbestritten, dass die Terrororganisation Hamas mit ihrem barbarischen Angriff den Konflikt ausgelöst hat. Die militärische Antwort empfinden sogar viele in Israel und der engste Verbündete USA als unverhältnismäßig. Gefordert werden Verhandlungen über einen Waffenstillstand.
Tote über Tote
Anders ist derzeit noch die Situation in der Ukraine. Wie viele Tote die russische Aggression bislang gefordert hat, ist unbekannt. Die kolportierten Zahlen gehen weit auseinander, es sind aber jedenfalls Hunderttausende.
Auch hier ist die Schuldfrage eindeutig. Sind aber deshalb Forderungen nach einem Waffenstillstand nicht statthaft? Würden sie Putins Aggression automatisch rechtfertigen? So sehen das offensichtlich viele, denn im Gegensatz zum israelisch-palästinensischen Konflikt fehlen Zurufe aus dem Westen, zumindest für einige Zeit einen Waffenstillstand anzustreben.Eine der wenigen Stimmen kommt von Vorarlbergs Militärkommandant Gunther Hessel. Er hat am Samstag im VN-Interview gemeint, er sei angesichts der militärischen Pattsituation für Verhandlungen über einen Waffenstillstand: Die Diplomatie müsse „im Hintergrund Druck ausüben“.
In den bekanntlich immer unsozialer werdenden „sozialen Medien“ ging es daraufhin rund: „Naivität“ und „armselige Argumentation“ waren die harmlosesten Vorwürfe, auch von einem „Büttel Putins“ war da die Rede. Ein „Büttel“, wer das Sterben beenden will?
Es ist verstörend, dass in Deutschland ausgerechnet die Grünen als einstige Friedenspartei vehement immer mehr und immer gefährlichere Waffen in einen Krieg schicken wollen, der gegen die Atommacht Russland nicht zu gewinnen ist. Früher hieß es einmal „Frieden schaffen ohne Waffen“. Jetzt soll anscheinend die Ukraine einen Stellvertreterkrieg für „den Westen“ führen – und blutet dabei aus.
Stimme aus der Ukraine
Was bei uns in der Debatte tabuisiert wird, sagt Andrij Melnyk unverblümt. Dabei ist der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland zu Beginn des Krieges als Scharfmacher aufgefallen: „Mir ist es gelungen, die Berliner Politik aus ihrer Lethargie zu holen.“ Im Interview mit dem „Tagesspiegel“ meint er: „Nach meiner persönlichen Überzeugung wäre es klug, wenn unsere Verbündeten diskret in Moskau ausloten könnten, ob echte Kompromissbereitschaft besteht.“
Am Montag hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine nicht mehr ausgeschlossen. Zurecht zeigte sich daraufhin Bundeskanzler Karl Nehammer besorgt und auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz schließt dies zum Glück kategorisch aus. Europa hat die Wahl zwischen Diplomatie und Eskalation. Letzteres bis zum globalen Krieg, der uns an den Rand der Vernichtung bringen könnte? Jetzt braucht es besonnene Politik und keine Kriegstreiberei!
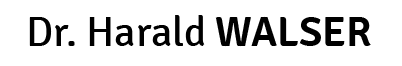

 Ist Ursula von der Leyen noch zu helfen? Die Präsidentin der EU-Kommission taumelt in der EU-Außenpolitik nur so dahin. Und die mächtigstens Staatschefs der Union unterstützen sie dabei oft sogar. Den Schaden haben wir alle. Sichtbar wird das derzeit vor allem in der Frage, ob die Ukraine rasch in die EU aufgenommen werden soll. Mein Kommentar dazu in den Vorarlberger Nachrichten unter dem Titel „
Ist Ursula von der Leyen noch zu helfen? Die Präsidentin der EU-Kommission taumelt in der EU-Außenpolitik nur so dahin. Und die mächtigstens Staatschefs der Union unterstützen sie dabei oft sogar. Den Schaden haben wir alle. Sichtbar wird das derzeit vor allem in der Frage, ob die Ukraine rasch in die EU aufgenommen werden soll. Mein Kommentar dazu in den Vorarlberger Nachrichten unter dem Titel „ Wie kann eine Exit-Strategie aus dem Ukraine-Krieg ausschauen? Darüber wird in den kommenden Tagen und Wochen hoffentlich intensiv nachgedacht werden. Was besonders Angst macht: Mit Putin ist eine Nachkriegsordnung nicht vorstellbar, aber er sitzt – so macht es jedenfalls den Eindruck – fest im Sattel. Was aus meiner Sicht dennoch wichtig ist: Russland ist nicht Putin! Unter dem Titel „Desaster im Osten“ habe ich zu diesem Problem Stellung bezogen. Hier zum Nachlesen:
Wie kann eine Exit-Strategie aus dem Ukraine-Krieg ausschauen? Darüber wird in den kommenden Tagen und Wochen hoffentlich intensiv nachgedacht werden. Was besonders Angst macht: Mit Putin ist eine Nachkriegsordnung nicht vorstellbar, aber er sitzt – so macht es jedenfalls den Eindruck – fest im Sattel. Was aus meiner Sicht dennoch wichtig ist: Russland ist nicht Putin! Unter dem Titel „Desaster im Osten“ habe ich zu diesem Problem Stellung bezogen. Hier zum Nachlesen: